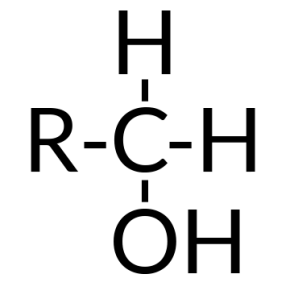Es ist in der Fachdiskussion nicht unumstritten, ab genau welcher Menge Alkohol bleibende Schäden verursacht. Aber selbst wenn verschiedenste Faktoren wie Körpergewicht, Erbveranlagung, Trinkverhalten und andere mehr eine Rolle bei dieser Berechnung spielen, geben viele als Richtwert 40 Gramm Alkohol pro Tag an. Das entspricht einem Liter Bier oder einem halben Liter Wein. Wer mehr trinkt, läuft Gefahr, seinen Körper zu zerstören. Die bekanntesten Schäden richtet Alkohol in der Leber an. Dieses Organ muss jeden Tag 2000 Liter Blut von allen möglichen Schadstoffen sauber waschen. Das Zellgift Alkohol zerlegt die Leber in Essigsäure und Kohlendioxid, wobei als Nebenprodukt das hochgiftige Acetaldehyd produziert wird. Dieses toxische Abbauprodukt verarbeitet die Leber zu Acetat. Die typischen Symptome eines Alkoholkaters beruhen auf der zu großen Menge von Acetaldehyd, die sich durch übertriebenen Alkoholgenuss angestaut hat. Doch die Schäden, die der Alkohol in der Leber anrichtet, sind nur vorübergehend wie ein Rausch und Kater. Aufgrund der Vergiftung durch Alkohol geraten der Stoffwechsel und Hormonhaushalt der Leber im Lauf der Jahre immer mehr durcheinander. Im Gewebe des Organs stauen sich Fettsäuren, die nicht mehr abtransportiert werden können. Man spricht von einer „Fettleber“, die sich bei rechtzeitiger Diagnose und Verzicht des Patienten auf Alkoholgenuss durch einen Selbstheilungsprozess noch zurückbilden kann. Wenn der Alkoholmissbrauch fortgesetzt wird, zerstört sich irgendwann einmal das Lebergewebe, was im Endstadium eine vernarbte Schrumpfleber herausbildet, die sogenannte Leberzirrhose. In den entzündeten Leberteilen können sich bösartige Krebszellen heranbilden. Dann kommt es zu einem Lebertumor. Eine kaputte Leber bringt auch den Blutkreislauf durcheinander. Das Organ reinigt das Blut auf seinem Weg vom Verdauungstrakt zum Herzen. Wenn es nicht mehr funktioniert, staut sich das Blut vor der Leber und muss sich einen alternativen Verlauf zum Herzen über die Venen der Speisröhre suchen. Doch für so viel Flüssigkeit sind diese Adern nicht gemacht. Sie schwellen an und reißen. Es kommt zu inneren Blutungen. Dieses Platzen der Ösophagusvarizen ist eine typische Alkoholikerkrankheit, kann aber auch bei anderen Fehlfunktionen der Leber auftreten. David Wagner spricht in seinem bekannten Buch „Leben“ aus dem Jahr 2013 von solchen lebensgefährlichen inneren Blutungen, die eine Lebertransplantation nötig machen. Doch nicht nur die Leber, auch die Bauchspeicheldrüse reagiert extrem sensibel auf das Zellgift Alkohol. Auch hier kommt es bei chronischem Alkoholmissbrauch zur Entzündung (Pankreatitis), die schnell chronisch wird, Schmerzen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust und Erbrechen verursacht und, weil die insulinbildenden Zellen zerstört werden, eine Diabetes zur Folge hat. Geht der Alkoholkonsum weiter, wird die Bauchspeicheldrüsenentzündung chronisch und es entsteht Bauchspeicheldrüsenkarzinom. Auch hier wie beim Leberkrebs handelt es sich oft um Spätfolgen jahrzehntelangen Alkoholkonsums, da sowohl die Leberzirrhose als auch die chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung mit ihrem entarteten Zellwachstum und dem mutierten Stoffwechsel einen idealen Nährboden für die Bildung von Tumoren bereitstellen. Alkohol greift auch in den Blutkreislauf ein, steigert den Blutdruck und führt zu Herzrhythmusstörungen. Wenn noch weitere Faktoren wie Übergewicht oder Stress dazukommen, steigt auch die Gefahr eines Herzinfarkts. Auch das Nervensystem wird vom Alkohol angegriffen. Zu Beginn sind die Symptome oft noch relativ harmlos. So klagen Alkoholiker oft über Schmerzen an den Beinen und Muskelkrämpfe, was auf Schäden an den peripheren Nervenbahnen hindeutet. Doch es sind vor allem die Auswirkungen auf das Gehirn, die am besorgniserregendsten sind. Dass jeder Vollrausch Millionen von Gehirnzellen abtötet, mag vielleicht noch mit einer witzigen Bemerkung abgetan werden. Alkohol und Nikotin rafft die halbe Menschheit hin. Aber ohne Bier und Rauch, stirbt die andre Hälfte auch. Doch die feucht-fröhlichen Witzchen bleiben einem schnell im Halse stecken, wenn man weiß, dass übermäßiger Alkoholkonsum die Gedächtnisleistung und das Konzentrationsvermögen negativ beeinflusst. Man tut sich immer schwerer, intelligente Urteile zu bilden. Im Endstadium zerstört der Alkohol die Persönlichkeit sowohl im physischen als auch im psychischen Bereich. Es kommt zu vom Alkohol verursachten Demenzphänomenen. Bevor es zu spät ist, sollte man reagieren. Wenn der eigene Wille nicht ausreicht, um den Alkoholkonsum zu verringern (wozu das Eingeständnis falscher Trinkgewohnheiten unabdinglich ist), sollte man an eine Entwöhnungstherapie denken. In leichteren Fällen kann diese ambulant durchgeführt werden. Eine solche Therapie kostet viel Kraft und wird nur erfolgreich durchgeführt werden können, wenn es die Lebenssituation erlaubt. Andernfalls ist eine stationäre Behandlung angebracht. In speziellen Fachkliniken wird in einem Zeitraum, der bis zu vier Monaten dauern kann, eine stationäre Alkoholentwöhnung durchgeführt. Zwischen Leber und Milz passt dann kein Pils mehr.
© Wolfgang Haberl 2017